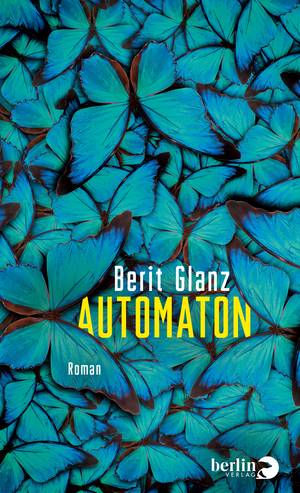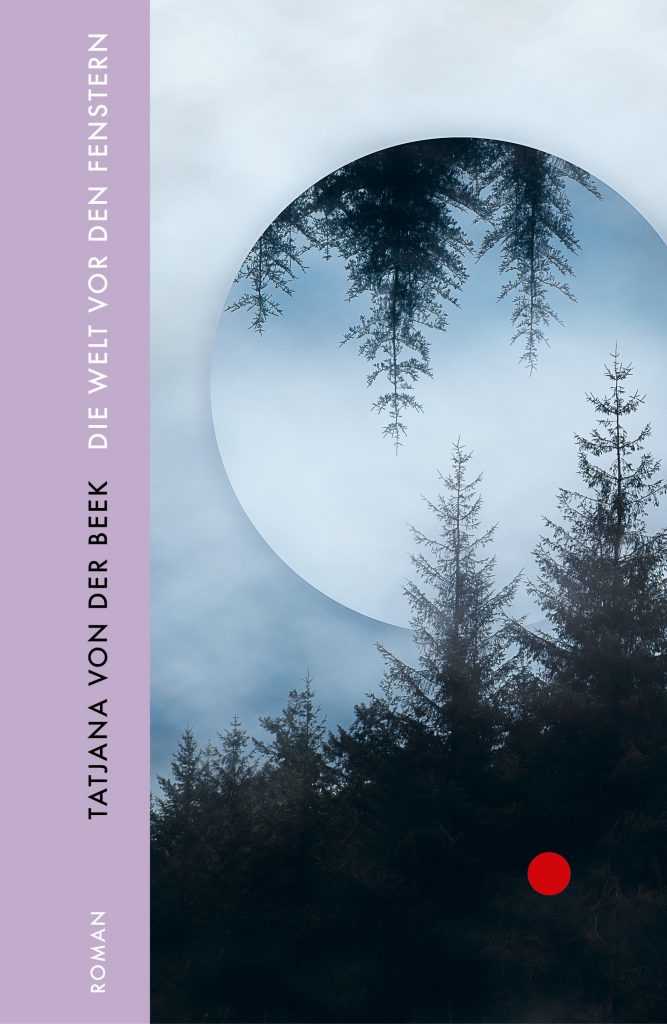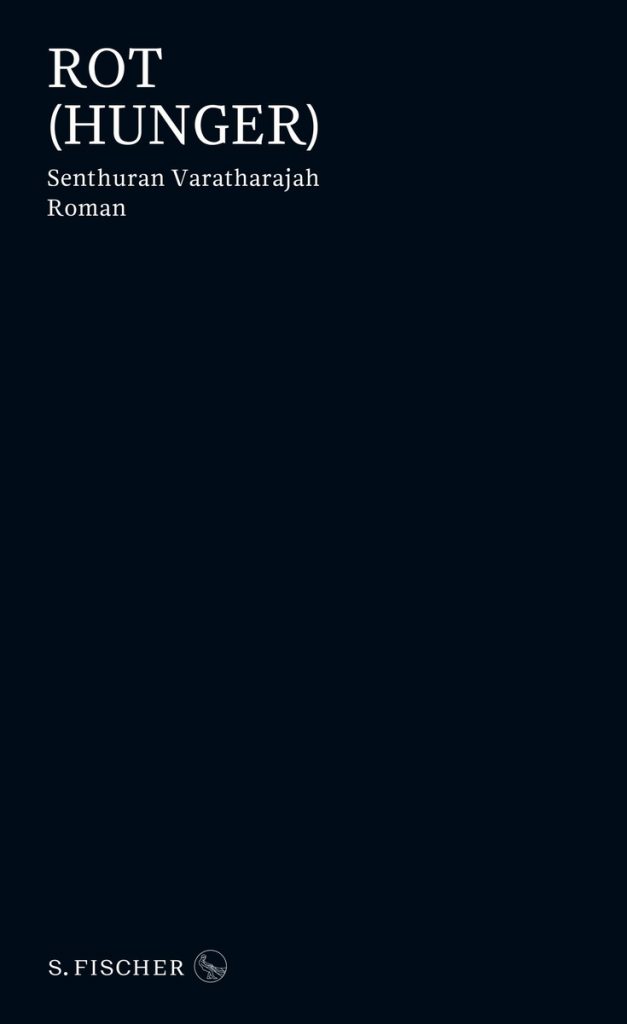Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Firmengeschichte zu schreiben? Im wörtlichen Sinne?
Firmengeschichten werden immer beliebter und geben Kundinnen, Kunden und Partnern einen fantastischen Blick hinter die Kulissen. Sie bieten außerdem eine Möglichkeit, Ihr Unternehmen ins richtige Licht zu rücken – sie sind das perfekte Marketing-Tool.
Welche Form passt zu Ihrer Firmengeschichte?
Grundsätzlich können Sie die Geschichte Ihres Unternehmens in zwei Formen gestalten: als „Über uns“-Text auf Ihrer professionellen Website oder als Printprodukt zu Jubiläen oder besonderen Meilensteinen. Wie Sie Ihre Firmengeschichte am besten verpacken, hängt davon ab, für welche Form Sie sich entscheiden. Ein Website-Text muss kurz und knackig ausfallen. In einer gedruckten Chronik dagegen dürfen Sie ausführlich über die Ereignisse ihrer Firmengeschichte berichten.
Über uns – die Unternehmenschronik als Vorstellungstext auf der Website
Ein Unternehmen lebt von den Menschen, die dort arbeiten. Deshalb ist der Vorstellungstext auf Ihrer Website ein guter Ort, um auch auf die Geschichte Ihrer Firma zu sprechen zu kommen. Am besten funktionieren solche Texte, die emotional fesseln und eine persönliche Komponente mitbringen: Erzählen Sie von den Gründerinnen und Gründern und deren Visionen für das Unternehmen und über die Herausforderungen, die sie auf dem Weg überwunden haben.
Dabei ist es wichtig, dass Sie sich wirklich auf wenige Details konzentrieren, die relevant sind. Meilensteine, Wendungen und Krisen eignen sich am besten. Werfen Sie nicht mit Zahlen um sich, setzen Sie diese nur sparsam ein – für wirklich relevante Ereignisse. Eine Aneinanderreihung reiner Fakten langweilt Ihre Leserinnen und Leser, zu viele Zahlen führen schnell zu Verwirrung.
Grundsätzlich kann es sich lohnen, für dieses Textformat eine Agentur oder einen Textprofi zu beauftragen. So erhalten Sie einen SEO-optimierten Text, der sich perfekt in Ihre Website einfügt.
Ihre Firmengeschichte im Langformat
Mit einer gedruckten Firmenchronik haben Sie etwas Besonderes in der Hand, dass Sie geschätzten Partnern und Ihren Kundinnen und Kunden präsentieren können. Es lohnt sich also, auch einmal über eine Firmengeschichte in Langform nachzudenken – das kann eine Broschüre sein, aber auch ein ganzes Buch, z. B. zu einem Jubiläum. Im Gegensatz zum „Über uns“-Text auf Ihrer Website sollten Sie zur Planung und Herstellung dieser Firmengeschichte viel Zeit einplanen – vom Textentwurf über Bildauswahl und Produktion bis zum Druck können mehrere Monate vergehen.
Die Zusammenarbeit mit Text- und Designprofis ist bei gedruckten Firmengeschichten empfehlenswert. Einen so langen Text zu schreiben fällt nicht allen Menschen leicht. Der externe Blick oder sogar eine Schreibbegleitung von Beginn an können helfen, Texte lebendig und interessant zu machen.
Auch bei der Bildauswahl und beim Design ist der Blick von außen sehr wertvoll. Zusammen mit Designerin oder Designer entwickeln Sie Format und Aufmachungen – Text und Präsentation greifen ineinander und bilden ein rundes Ganzes.
Für eine gelungene Zusammenarbeit können Sie schon im Vorfeld aktiv werden.
Recherchieren Sie, bevor Sie schreiben
Gibt es noch Gründerinnen und Gründer des Unternehmens, die als Zeitzeugen befragt werden können? Was geben die Archive des Unternehmens her? Wie ist das Unternehmen in die lokalen Gegebenheiten eingebunden und wo taucht es in der Presse auf?
Tragen Sie zusammen, was Sie finden können und was Ihnen dabei helfen kann, sich ein vollständiges Bild von der eigenen Unternehmensgeschichte zu machen. Sie werden erstaunt sein, wie viel Sie bereits finden.
Ordnen Sie die Ereignisse ihrer Firmengeschichte
Damit kein wichtiges Ereignis verloren geht, sortieren Sie im nächsten Schritt die gesammelten Daten und picken die wichtigsten Ereignisse heraus, die auch Ihre Leserinnen und Leser interessieren werden. Dabei geht es nicht nur um die positiven Höhepunkte, sondern auch um Herausforderungen oder Probleme, die Ihrem Unternehmen begegnet sind. Gerade solche Krisen und Wendezeiten bringen Spannung in Ihre Geschichte und machen Sie als Unternehmen sympathisch. Abeer Achtung: Denken Sie hierbei immer aus Sicht Ihrer Leserinnen und Leser!
Wählen Sie das richtige Bildmaterial
Wenn Sie Ihre Unternehmenschronik später als Buch herausbringen möchten, sollten Sie schon frühzeitig bedenken, dass auch Bilder notwendig sind. Dabei gibt es wichtige Punkte, die Sie bedenken: Die Bilder müssen zum Erzählten passen und sie müssen die richtige Qualität haben. Besprechen Sie am besten schon frühzeitig mit Ihrem Designer oder Ihrer Designerin, welche Anforderungen erfüllt sein sollten.
Sprechen Sie die Sprache Ihrer Kundinnen und Kunden
Klar, so einen Text zu schreiben, fällt uns allen nicht leicht. Es gibt ein paar Tricks, die Ihnen dabei helfen, locker und lebendig zu erzählen. Statt in die sperrige Schriftsprache zu verfallen, versuchen Sie Folgendes: Nehmen Sie sich auf, wie Sie einem imaginären Gesprächspartner von Ihrem Unternehmen erzählen. Später können Sie diese Aufnahme nutzen, um daraus Ihren Text zu stricken.
Geschichten und Anekdoten machen Sie menschlich
Nur trockene Fakten machen uns Leserinnen und Leser auf Dauer nicht glücklich, oder nur die wenigsten. Was uns alle aber immer interessiert, sind die kleinen Geschichten und Anekdoten, die man auf der Party erzählt: skurrile Ereignisse, Überraschungen, kleine Tragödien – das macht eine gute Anekdote aus.
Schreiben Sie Ihre Firmengeschichte mit uns

Schreibcoaching und Lektorat
Ich begleite Sie beim Schreiben Ihrer Firmenchronik vom ersten Gliederungsentwurf bis zum fertigen Text. Gern übernehme ich auch das Projektmanagement und vermittle Dienstleister für Korrektorat und Druck.

Design und Satz, Druckvorbereitung
Grafikdesignerin Anke Sundermeier übernimmt alle Designschritte, berät Sie bei der Bildauswahl, erstellt das Druckformat und kommuniziert für Sie mit der Druckerei Ihrer Wahl.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lektorat-bergmann.de oder rufen Sie an unter 0177 6870047.