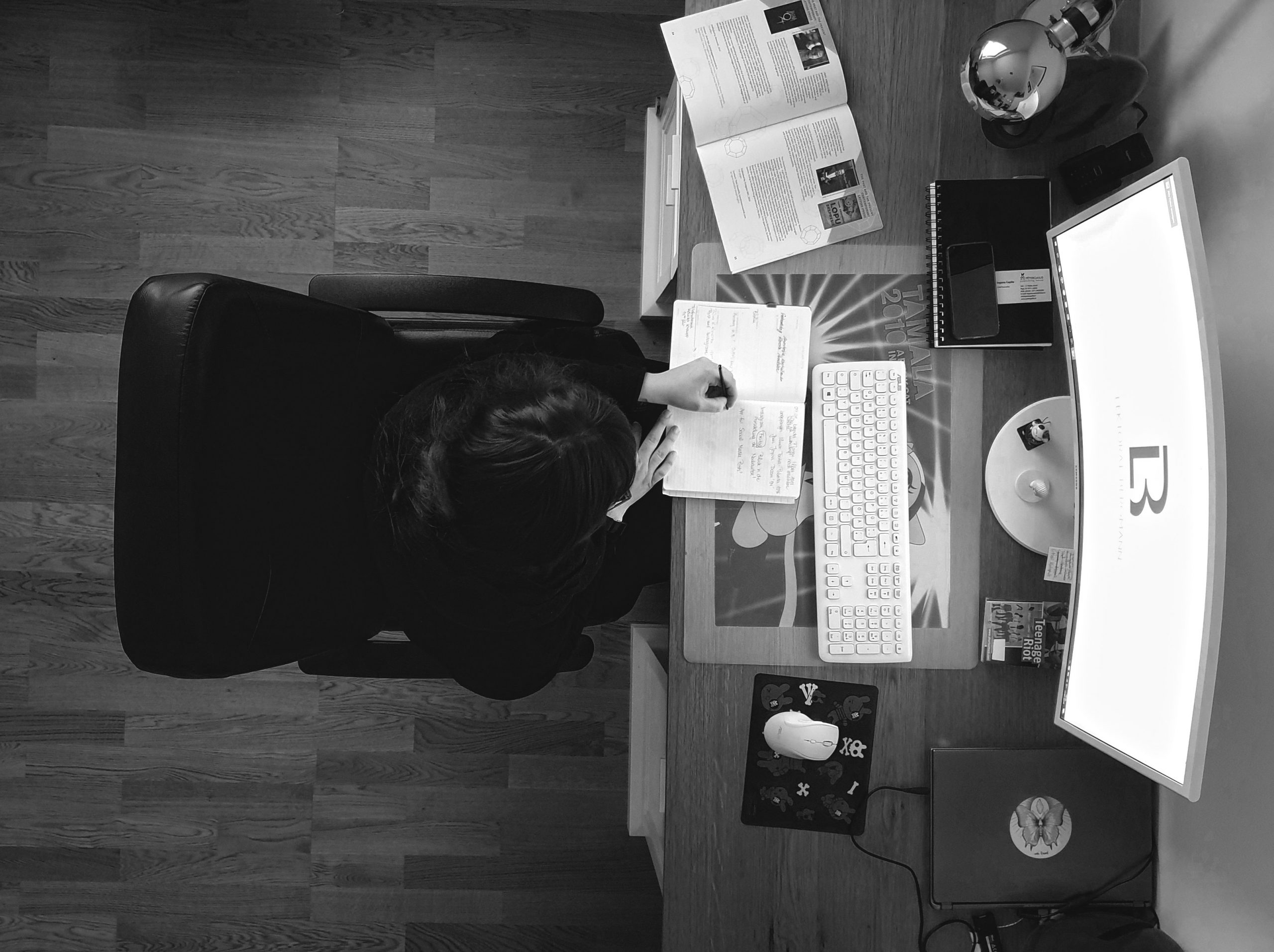Etwa 15 % aller Erstausgaben auf dem deutschen Buchmarkt waren im Jahr 2023 Übersetzungen. Jede vierte Neuerscheinung in der Belletristik stammt aus dem Ausland. Dabei haben noch immer die großen Sprachen Englisch und Französisch die Nase vorn, dazu kommt Japanisch.*
Doch bevor ein fremdsprachiges Werk deutsche Leser*innen erreichen kann, durchläuft es einen langen Prozess, der weitgehend für alle, die das Buch am Ende lesen werden, unsichtbar bleibt. Die Wege zur Übersetzung sind dabei so vielfältig wie der Buchmarkt selbst – von klassischen Agenturgeschäften bis zu direkten Kontakten zwischen Autor*innen und Verlagen.
*https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/buchproduktion/
Der traditionelle Weg über Agenturen als Vermittler
Wer im deutschen Buchmarkt beruflich zu Hause ist, kennt diese besonderen Tage auf der Frankfurter Buchmesse: Am Mittwoch und Donnerstag herrscht reges Kommen und Gehen. Bevor die Messe ab Freitag für alle Besucher*innen öffnet, werden hier Geschäfte gemacht: Agent*innen, Scouts, Lektor*innen treffen zusammen und pitchen Titel, kaufen Rechte und verhandeln über Lizenzausgaben.
Vor allem die Scouts behalten die internationalen Märkte das ganze Jahr über im Blick und wissen genau, welche Originaltexte das Potenzial für eine Übersetzung mitbringen. Und natürlich tragen sie diese nicht nur zur Messezeit an die Verlage heran, sondern in allen Monaten des Jahres.
Dieses Modell hat allerdings einen Preis: Bis zu 20 % Provision werden von den einkaufenden Verlagen verlangt, dazu kommen noch die Lizenzgebühren und die Honorare für Autorinnen – und da haben wir noch nicht einmal eine fertige Übersetzung. Natürlich hat dieses Modell auch Vorteile: Man kennt sich, die Vertragsverhandlungen sind hoch professionalisiert und die zeitlichen Abstände zwischen Originalwerk und Übersetzung werden immer kürzer.
Direkte Kontakte sparen Geld, kosten aber Zeit und Nerven
Alternativ entwickeln sich Übersetzungsprojekte gelegentlich aus persönlichen Gesprächen und neuen Kontakten. Bei Branchentreffen, auf der Messe, am Rande von Lesungen finden so vor allem kleinere Verlage mit Übersetzer*innen, ausländischen Publishern oder Länderplattformen zusammen und besprechen künftige Kooperationen.
Gerade in den kleinen Sprachen sind Übersetzungen sehr risikobehaftet für die deutschen Verleger*innen. Die Namen der Autor*innen sind häufig bei den deutschen Leser*innen noch nicht etabliert, die Kulturen fremd und wenig zugänglich. Ohne finanzielle Förderungen geht hier häufig nichts, zum Beispiel mit festen Beträgen für die Übersetzungsleistung an sich oder der Vermittlung von Kontakten zur Festivals und Literaturhäusern oder der Übernahme von Reisekosten für ausländische Autor*innen für Lesereisen. Dafür lassen sich die Konditionen für eine Übersetzung mit den ausländischen Verlagen leichter auszuhandeln auf dem direkten Weg.
Übersetzer*innen kommt bei der direkten Vermittlung von Titeln eine besondere Rolle zu, denn sie sind diejenigen, die Literatur aus dem Ausland an Verleger*innen empfehlen. Findet ein Titel Interesse, dann schreiben sie zum Beispiel zunächst ein Manuskriptgutachten, sodass klar ist, worum es geht und welche USP (Unique Selling Points – also Verkaufsargumente) ein Titel mitbringt. Passt das alles, geht es in die nächste Phase.
Vertragsverhandlungen: Ein bisschen wie Diplomatie, ganz viele Pitchdecks
Unabhängig davon, wie der Kontakt zustande kam – im nächsten Schritt geht es weiter mit Vertragsverhandlungen. Mit viel Glück verhandelt ein deutscher Verlag als einziger Bieter mit einem ausländischen. Häufig, und gerade bei sehr erfolgsversprechenden Titeln, starten jetzt die Pitches. Dabei präsentieren die bietenden Verlage anschaulich, zu welchen Konditionen sie den Titel einkaufen möchten.
Ein Pitch beinhaltet unter anderem:
- ein Angebot für die Lizenzgebühr
- Konditionen für die Autor*innen
- eine voraussichtliche Verkaufsauflage
- oft auch den Namen/die Namen von Übersetzer*innen, die für den Titel vorgesehen sind
- Marketingstrategien und Angaben, wie der Titel im Programm platziert werden soll
- Erscheinungsdatum
Bis ein Pitch steht oder ein Verlag ein Angebot abgeben kann, braucht es eine intensive Vorbereitung. Marktchancen werden eingeschätzt, Kalkulationen durchgeführt und erste Verhandlungen auch mit Übersetzer*innen geführt. Neben den Zahlungen an die ausländischen Verlage und Autor*innen müssen auch Übersetzungskosten, Kosten für Lektorat, Korrektorat und Herstellung natürlich ein Marketingbudget berücksichtigt werden. Diese Verhandlungen können unter Umständen sehr lange dauern, in manchen Fällen ziehen sie sich über Monate hinweg.
Glücklich also, wer im direkten Kontakt und ohne Konkurrenz um einen Titel feilschen kann. Hier geht es entspannter zu: ein paar E-Mails und persönliche Gespräche führen häufig zum Ziel. Aber auch hier gibt es viel zu tun, denn ein Vertrag ist lang und muss in vielen Punkten einzeln diskutiert und vereinbart werden.
Digitale Wege eröffnen neue Chancen
Der Weg eines Titels zu einer deutschen Übersetzung ist also komplex und vielschichtig. Und er wird sich in Zukunft weiter verändern, denn immer häufiger entdecken Lektor*innen Titel direkt. Und auch Selfpublishing wird interessanter. Nicht wenige englischsprachige Indie-Autor*innen sind an Übersetzungen interessiert und lassen sich nicht durch Agenturen vertreten – sie wollen selbst entscheiden.
Aber egal, auf welchem Weg ein Vertrag zustande kommt: Im nächsten Schritt kommt es auf die Übersetzer*innen an, die Brücken bauen für Leser*innen und ihnen fremdsprachige Titel nahebringen.